Immer geht es Dokumentarfilmen darum, Öffentlichkeiten zu erreichen und die Zuschauer_innen zum Weiterdenken anzuregen. Aus diesem Anspruch kann gesellschaftlicher Wandel resultieren – in den Köpfen der Menschen ebenso wie in politischen Gefügen. Im Kontext des zerfallenden Jugoslawien lässt sich dies anhand eines in unseren Breiten weitgehend unbekannten Korpus erörtern. Ein bruchstückhafter Einblick.
Von Andrea Reiter
Erschienen im Filmbulletin 8.19
Sehr früh nach der Ausrufung der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien – mit ihren sechs Teilrepubliken Serbien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Slowenien, Montenegro, Mazedonien sowie den beiden zu Serbien gehörenden autonomen Provinzen Kosovo und Vojvodina – erklärte Staatschef Josip Broz Tito, der das Land von 1945 bis zu seinem Tod 1980 regierte, den Film gemäss Lenins Maxime zur wichtigsten Kunstform im Kommunismus. Staatlich organisiert und in den meisten Phasen der Republik weitgehend selbstbestimmt, das heisst ohne restriktive zensorische Kontrolle, entwickelte sich so eine blühende Filmszene mit eigenständigen Traditionen, Schwerpunktsetzungen und individuellen künstlerischen Handschriften in den einzelnen Teilrepubliken, gerade auch im Dokumentarfilmbereich. Viele Dokumentarfilmschaffende zeigten sich politisch und sozialkritisch engagiert, befassten sich mit Ungerechtigkeit, gesellschaftlicher Unzufriedenheit, Arbeitslosigkeit, politischen Entwicklungen oder offizieller Geschichtsschreibung und erfuhren national wie international Beachtung. Da Jugoslawien Teil der blockfreien Staaten war, bestand für die Filmemacher_innen immer die Möglichkeit des internationalen Austauschs, sowohl was den Vertrieb eigener Werke als auch die Inspiration durch künstlerische Strömungen anbelangt.
Der Zerfall Jugoslawiens führte für die Filmemacher_innen der Region zu einem Konflikt mit den spezifischen aktuellen Gegebenheiten. Mit Dokumentarfilmen vielschichtige Sachverhalte in ihrer Komplexität aufzuzeigen, Kritik an den dominanten Rhetoriken der politischen Eliten zu üben und sich damit Gehör zu verschaffen, war in den neu entstandenen Nationalstaaten, vor allem im ersten Jahrzehnt ab 1991 – dem Ausgangspunkt des Zusammenbruchs der Republik –, ein äusserst schwieriges Unterfangen. Nicht nur waren die Bedingungen für die Produktion praktisch über Nacht weitgehend ausser Kraft gesetzt, was bezüglich Finanzierung, Herstellung und Vertrieb auf das gesamte Filmschaffen Auswirkungen hatte. Weit schwerer wogen die staatlichen Restriktionen gegen jegliche Formen des politischen Widerstands. So versuchten die neuen Regierungen durch mediale Kontrolle und Propaganda ihre nationale Politik zu rechtfertigen und zu stärken. Dennoch existierte von Anfang an in allen Ländern Ex-Jugoslawiens ein, wenn auch über lange Jahre marginales, kritisches Medien- und Dokumentarfilmschaffen, das sich der Auseinandersetzung mit dem gewaltsamen Zerfall und seinen Ursachen sowie den sich daraus ergebenden Problemen der jugoslawischen Nachfolgestaaten widmete. Kritische Dokumentarfilme jener Zeit ermutigten die Zuschauer_innen – vor allem jene vor Ort, aber auch ein internationales Publikum mitsamt den im Ausland lebenden «Ex-Jugoslaw_innen» – zur kritischen Reflexion über die populistisch-nationalistischen Entwicklungen und zur politischen Einmischung.
Ein zentraler Protagonist ist der Filmemacher Želimir Žilnik. Mit dem «Mockumentary» Tito zum zweiten Mal unter den Serben (Tito po drugi put među Srbima, BRJ 1994) schuf er in der Vermischung von Realität und Fiktion ein herausragendes Beispiel für jene durchaus zahlreichen dokumentarischen Interventionen, die in den Neunzigerjahren realisiert wurden – in Serbien hauptsächlich unter dem (einen gewissen Schutz bietenden) Label des kritischen Radiosenders B92, der auch Dokumentarfilme produzierte. Žilnik, ein seit den Sechzigerjahren anerkannter, unabhängiger Filmemacher, der aufgrund seiner kritischen Themen in Jugoslawien mit einem zeitweiligen Berufsverbot belegt worden war, nimmt in seinem Verwirrspiel zwischen Erfundenem und Authentischem den Zustand der Gesellschaft mittels der inszenierten Wiederkehr des verstorbenen Staatspräsidenten Josip Broz Tito in den Strassen der serbischen Hauptstadt Belgrad in Augenschein. Mit eiserner Hand und mächtigem Personenkult hatte Tito den Vielvölkerstaat unter dem Leitspruch von Brüderlichkeit und Einheit regiert und Sonderwünsche und nationalistische Neigungen der einzelnen Völker unterbunden. Nach seinem Tod hatte die Neuordnung der Macht begonnen, was, verschärft durch die ökonomische Krise, aufflammende nationalistische Tendenzen sowie ethnische Spannungen in einzelnen Regionen, zu einer Eskalation und zum Zerfall Jugoslawiens führte. Žilnik irritierte nach eigenem Bekunden, dass in dieser Zeit des Umbruchs eine falsche Diskontinuität zwischen Titos Herrschaft und der blutigen Zerstückelung der sozialistisch-föderativen Republik propagiert wurde. Der ehemalige Führer galt als Persona non grata. Man hatte Monumente entfernt und Strassen umbenannt. Die politischen Eliten setzten alles daran, ihre Beziehungen zum Titoismus und ihre durch Tito beförderten Karrieren vergessen zu machen. In diesem Zusammenhang spielten die Medien eine entscheidende Rolle. Unter Einfluss der Politik hatten sie mit einer einseitigen, populistischen und oft falschen Berichterstattung die Bevölkerung auf ein nationalistisches Gedankengut eingeschworen, ethnische Spannungen und Hass geschürt und Serbien als von Feinden umzingelt beschworen.
Um diese Zusammenhänge filmisch zu erforschen, durchkreuzt der Regisseur die politische Strategie des Vergessens, indem er den als Tito verkleideten Schauspieler Dragoljub S. Ljubičić mit einem Kamerateam durch die Innenstadt begleitet. Als wisse dieser nicht, was in «seinem» Land los sei, lässt sich der falsche Tito von den Passant_innen die aktuellen Entwicklungen erläutern, fordert sie auf, ihm zu erklären, warum man dem serbischen Volk international keinen Glauben mehr schenke und es mit Sanktionen belege. Allen ist der Schwindel bewusst, dennoch nutzen sie die Performance, um über das politisch Verleugnete zu diskutieren, Positives und Negatives gegeneinander abzuwägen und eine Vielfalt politischer Positionierungen zu formulieren. Im Dialog mit dem «Auferstandenen» zeigt sich, dass die Einschätzung der Belgrader Bevölkerung zur Politik der serbischen Regierung keineswegs einheitlich befürwortend war. Das Problem war vielmehr, dass kritische Haltungen zu selten an die Öffentlichkeit gelangten, weil neben den staatlich kontrollierten Medien kaum alternative Plattformen existierten. In diesem Klima der Unsicherheit strebten die Filme von B92 die Aktivierung der gesellschaftlichen Selbstverantwortung an. Sie rückten Themen in den Blick, die in den staatlichen Medien keine Beachtung fanden, ohne jedoch der politischen Propaganda durch Gegenpropaganda zu begegnen. In Žilniks wie in vielen anderen Filmen lag eine Aufforderung an die Zuschauer_innen begründet, ihre eigene Haltung zu überdenken.
Es ist schwer zu beurteilen, wie die Bevölkerung den Tito-Film aufnahm, der über längere Zeit in einem unabhängigen Kino in Belgrad zu sehen war und später auf VHS-Kassette scheinbar unbeobachtet vertrieben werden konnte. Auch ist unklar, warum ihn viele regimetreue Medien nach der Premiere – wenn auch ohne auf die hintergründige Kritik einzugehen – rezensierten und es vonseiten der Politik keinerlei Reaktionen gab. In den Artikeln nach der Erstaufführung des Films erfährt man nichts darüber, sie bleiben oberflächlich. Was sich an diesem Beispiel zeigt, ist das widersprüchliche Verhalten der Regierung. Auf der einen Seite agierte sie totalitär und ablehnend gegenüber jeglicher Kritik am System, auf der anderen Seite räumte sie Žilniks und anderen B92-Filmen gewisse Freiheiten ein. Der Filmemacher erklärte dies salopp mit dringenderen Problemen, die «Milošević und seine Vasallen» in jener Zeit umgetrieben hätten. Nach aussen hin konnte die Regierung so zudem ihren demokratischen Anspruch zur Schau stellen.
Dass aus einer marginalisierten Innenperspektive zuweilen landesweit und über die Grenzen hinaus grosse Aufmerksamkeit generiert wurde, zeigt Janko Baljaks kontroverser Dokumentarfilm The Crime that Changed Serbia – See You in the Obituary (Vidimo Se U Čitulji, BRJ 1995), der im April 1995 beim Jugoslawischen Dokumentar- und Kurzfilmfestival den Preis der besten Videoarbeit gewann. Der Regisseur hatte in Zusammenarbeit mit den beiden Journalisten Aleksandar Knežević und Vojislav Tufegdžić und basierend auf deren Buchprojekt einen Film realisiert, der das Phänomen der gewalttätigen, sich ausbreitenden Unterwelt Serbiens und insbesondere Belgrads thematisiert. Baljaks Film verdeutlicht, dass mit dem Zerfall Jugoslawiens eine Parallelgesellschaft entstand, deren Unterbindung oder zumindest Eingrenzung die Staatsführung nicht konsequent verfolgte. Zudem werden Verbindungslinien zwischen der serbischen Mafia und den Kriegen in Kroatien und Bosnien-Herzegowina vor dem Hintergrund der UN-Sanktionen offenbar – während die serbische Regierung jegliche Verbindung zu den Kriegen in den Nachbarländern kategorisch leugnete. So spannt The Crime that Changed Serbia einen argumentativen Bogen von der organisierten Kriminalität zu staatspolitischen Interessen, vor dem Hintergrund einer nationalistischen, grossserbischen Vision.
Das Besondere an Baljaks Film ist, dass er die zentralen «alteingesessenen» und «neuen» Figuren der Belgrader Schattenwelt vor seiner Kamera versammelt und zu Wort kommen lässt. Durchtrainiert, tätowiert und mit schweren Goldketten und -armbanduhren ausgestattet, präsentieren sie sich weltgewandt, arrogant und überzeugt von sich und ihren Taten. Trotz des investigativen Charakters und der szenisch angelegten Selbstentblössung erzielte der Film nicht nur die gewünschte aufklärerische Wirkung. Viele Zuschauer_innen interessierten sich nämlich nicht für das imaginative Movens des Films als Fürsprecher eines politischen Wandels, vielmehr betrachtete ein vornehmlich jüngeres Publikum in Serbien den Film nach seiner Festivalpremiere als absoluten Kult und die Protagonisten als Stars.
Anders als in Serbien stellte sich die Situation in der ersten Hälfte der Neunzigerjahre in Kroatien dar. Die Republik war nach der Unabhängigkeitserklärung im Juni 1991 von jugoslawischen und serbischen paramilitärischen Einheiten angegriffen und teilweise besetzt worden. In einem Verteidigungskampf versuchten kroatische Truppen, das Territorium zu schützen. Unabhängige Medien oder ein Kommunikationsraum engagierter Gegendiskurse konnten sich nicht etablieren, und eine nationalistische Opferperspektive dominierte die politische Rhetorik. Dennoch formierte sich im Laufe der Jahre Widerstand unter den Filmschaffenden.
Innerhalb eines staatlich kontrollierten Rahmens versuchte Ivan Salaj mit Hotel Sunja (HR 1992), koproduziert vom nationalen Fernsehen HRT und der Akademie der Darstellenden Künste Zagreb, das Publikum für einen kritischen Blick zu sensibilisieren. Sein Film befasst sich mit den Auswirkungen des Kriegs auf seine Generation und nutzt das bei den Zuschauer_innen vorausgesetzte Wissen darüber, was offen debattiert werden darf und was besser unausgesprochen bleiben sollte. Anhand von Andeutungen stört er die offizielle Rhetorik von Verteidigung und soldatischem Heldentum. Er dokumentiert zwischen Ende April und Anfang Mai 1992 eine Gruppe von Soldaten an der Front, kurz nachdem mit internationaler Hilfe ein Waffenstillstandsabkommen zwischen kroatischen und serbischen Truppen ausgehandelt worden war. Die überwiegend jungen Männer leben jedoch weiterhin in Alarmbereitschaft. Sie haben sich im zentral gelegenen Hotel eingerichtet, um dort die Entwicklungen des aktuellen Waffenstillstands abzuwarten, während das Dorf Sunja auf drei Seiten von serbischen Einheiten abgeriegelt ist. In dieser Phase des Wartens dokumentiert Salaj das «unspektakuläre Alltägliche». Er zeigt die Soldaten beim Rauchen und Kartenspielen, beim gemeinsamen Abendessen, beim Säubern des Hauses, beim Zähneputzen oder beim Reinigen der Waffen. Dabei bringen die Bilder Unordnung und Disziplinlosigkeit zum Vorschein. Alles in dem zur Kaserne umfunktionierten Hotel erweckt den Eindruck, improvisiert zu sein. Jeder der Soldaten scheint zu tun, wonach ihm der Sinn steht. Die «fotografische Botschaft», von der Roland Barthes als dem «buchstäblich Wirklichen» spricht, enthält hier auf denotativer wie konnotativer Ebene die Botschaft der Erschöpfung und der Schwäche. Hotel Sunja zeigt junge Männer, die im Kampf um den Erhalt der Nation an ihre psychischen Grenzen gelangen. Gerade weil das hier gezeichnete Bild letztlich als «dokumentarische Metonymie eines jeden Krieges» zu verstehen ist, wie es der Schriftsteller Evner Kazaz beschreibt, manifestiert sich in der filmischen Perspektive eine Antikriegsposition.
Zvonimir Jurić wiederum spürt in seinem The Sky below Osijek (Nebo ispod Osijeka, HR 1995) dem psychischen Zustand junger Erwachsener in der ostkroatischen Stadt Osijek direkt nach Kriegsende nach. Aufgrund der Nähe zu Serbien lebten die Jugendlichen während des nie gänzlich durchgesetzten Waffenstillstands in einer Ausnahmesituation, die von sporadischen Angriffen und Gewalt geprägt war. Jurićs Schwarzweissfilm zeichnet sich durch eine deutlich subjektive und zugleich ästhetisierte Erzählweise aus. Im Stil einer assoziativ entwickelten Dramaturgie umkreist auch er das traumatische Erleben des Kriegs und präsentiert so das Bild einer Generation, die kurz nach dem kroatischen Rückeroberungsfeldzug «Operation Sturm» (Operacija Oluja) und dem Friedensvertrag von Dayton zu einem normalen Leben zurückzufinden versucht. Wie bereits der Filmtitel in Anspielung an Wim Wenders’ Himmel über Berlin andeutet, sind die Verhältnisse im Nachkriegs-Osijek – Jurićs Heimatstadt – aus dem Lot geraten. Doch die Stimmen, die den Film strukturieren, offenbaren, dass diese Menschen die Schrecken des Kriegs hinter sich gelassen haben und sich ihrer Zukunft zuwenden.
Ein dritter Fokus auf jene Länder, die direkt in die kriegerischen Auseinandersetzungen involviert waren, gilt Bosnien-Herzegowina, das während des Kriegs (1992–1995) zu weiten Teilen besetzt war. Die Hauptstadt Sarajevo hatten bosnisch-serbische paramilitärische Einheiten nahezu vollständig von der Aussenwelt abgeschnitten. Ihre Taktik zielte auf eine Schwächung der Zivilbevölkerung und die Zerstörung des multiethnischen Zusammenlebens in dieser Region. Wegen der Abriegelung fehlte es an allem Lebensnotwendigen wie Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln und Medikamenten, weitaus schlimmer war allerdings die konstante Bombardierung aus den umliegenden Hügeln. Dennoch führte die Extremsituation zu künstlerischer Kreativität und Produktivität – vor allem auch im Dokumentarfilmbereich –, wobei verschiedene Motivationen zusammenkamen: der Wunsch, das Leben im Krieg filmisch festzuhalten, Gegenbilder zur nationalen Propaganda zu schaffen und Zeugnis von der alltäglichen Wirklichkeit abzulegen. Gleichzeitig sollte der internationalen Medienberichterstattung mit ihren zahlenbasierten Beiträgen und Simplifizierungen der komplexen Situation ein anderes Bild entgegengestellt werden, mit dem Ziel, bei den internationalen Zuschauer_innen ein Bewusstsein für die humanitäre Katastrophe des Kriegs zu erwecken. Darüber hinaus gab es das Bedürfnis, dem eigenen Leben mithilfe der künstlerischen Arbeit einen Sinn und Menschen in der gleichen Situation durch die Filme Hoffnung zu machen.
Die in Sarajevo ansässigen Filmemacher_innen realisierten in den Jahren der Belagerung über fünfzig kürzere und längere Dokumentarfilme. Sie dokumentierten den Kampf ums Überleben, die Zerstörung von Lebensräumen oder die Auswirkung des Kriegs auf den Alltag der Kinder. In meist unkommentierten filmischen Beobachtungen stellten sie das Menschliche und die Menschlichkeit dieser trotz Krieg und Hass für einen multiethnischen bosnisch-herzegowinischen Staat einstehenden Gesellschaft ins Zentrum, ohne auf die Angreifer oder die Ursachen des Kriegs einzugehen. Ein herausragendes Beispiel ist der auf 16 mm gedrehte Ecce Homo: Behold the Man (Evo čovjeka: Ecce homo, BIH 1994) von Vesna Ljubić: Der Film richtet den Blick auf die Strassen, Plätze und Hügel der Stadt und zeigt in poetisch verdichteter Form, wie die Menschen unter ständiger Lebensgefahr ihren Alltag bestreiten, wie sich ihr Leid durch die immer zahlreicher werdenden Toten vergrössert und dass der fortschreitenden Zerstörung kein Einhalt geboten wird. Es ist ein Film über Leben, Sterben und gesellschaftliche Resilienz, der als ethische Reflexion über die Folgen von Krieg zu lesen ist. Filme wie Ecce Homo unterminieren den sowohl in der Medienberichterstattung aller Nachfolgestaaten Jugoslawiens als auch in den internationalen Medien vorherrschenden Erklärungsansatz, nach dem vermeintlich unausweichliche ethnisch und historisch bedingte Spannungen das gesellschaftliche Leben dominiert und zum Krieg geführt hätten.
Während die Nachkriegsjahre weiterhin von den schwierigen politischen sowie produktionellen Verhältnissen geprägt waren, machte sich um die Jahrtausendwende – nachdem die dominanten, am Krieg beteiligten Staatschefs abgetreten (Alija Izetbegović in Bosnien-Herzegowina), verstorben (Franjo Tuđman in Kroatien) oder vor ein internationales Strafgericht gestellt worden waren (Slobodan Milošević in Serbien) – eine dokumentarfilmische Aufbruchstimmung bemerkbar. Die filmischen Strategien präsentierten sich komplexer, Gegenöffentlichkeiten wurden klarer thematisiert, Tabus gebrochen und subjektive Perspektiven vermittelt. Das lag am schwindenden politischen Druck auf die Filmschaffenden sowie an den sich wandelnden finanziellen Möglichkeiten und einem sich verstärkenden Austausch auf internationaler Ebene.
Im persönlichen, selbstreflexiven Dokumentarfilm Images from the Corner (Slike sa ugla, BIH, D 2003), der sich mit der postjugoslawischen Gesellschaft befasst, richtet die Filmemacherin Jasmila Žbanić die Kamera auf sich selbst, um aus ihrer persönlichen Warte ideologisch dominante Diskurse und restriktive soziale Praktiken einer Kritik zu unterziehen. Für ihre filmische Erkundung arbeitet die Regisseurin mit Inszenierungen, Reenactments, visualisierten Imaginationen und beobachtenden Bildern im Nachkriegs-Sarajevo. Bei all dem versucht sie, leidvolle «Erinnerungsspuren» zu erschliessen und ihnen neue Bilder gegenüberzustellen. Ausgangspunkt sind traumatische Erlebnisse, die viele Jahre nach Kriegsende im Unbewussten weiterhin wirken und durch zufällige Wahrnehmungen oder Ereignisse jederzeit blitzhaft zutage treten können. Diese Unmittelbarkeit dokumentiert sie in der Eröffnungssequenz anhand der filmischen Rekonstruktion eines Zirkusbesuchs, bei dem ihr das, wie sie sagt, «schmerzhafteste und schwierigste Bild aus dem Krieg» wieder vor Augen trat. Sie sieht eine Pferdedompteurin, die sie an ihre Schulkameradin Biljana denken lässt, die zu Beginn des Kriegs im Jahr 1992 als Erste aus Žbanićs Umfeld bei einem Granatenangriff in der Nähe ihres Wohnhauses lebensgefährlich verletzt wurde.
Die Suche nach der visuellen Repräsentation des Leidens und einer Ethik der Bilder, die Žbanić dabei umtreibt, spitzt sie anhand eines aus unterschiedlichen Perspektiven aufgegriffenen Bildmotivs zu: jenem Ort des Geschehens, an dem ein französischer Kriegsfotograf das blutüberströmte Mädchen Biljana mit ihrem toten Hund im Arm fotografierte und damit später den World Press Photo Award gewonnen hatte. Das Foto selbst bekommen weder die Zuschauer_innen zu sehen, noch hat es die Regisseurin nach eigenem Bekunden jemals zu Gesicht bekommen. Das kaleidoskopische Verweben der Erzählstränge, in dem sich ihr tastendes, suchendes Vorgehen abzeichnet, wird auf visueller Ebene durch unvermittelte Detailaufnahmen und sprunghafte Schnitte verstärkt. Fragmentarisch wird dabei die Lebensgeschichte Biljanas rekonstruiert, von der die Zuschauer_innen unter anderem erfahren, dass sie bei dem Anschlag ihren Vater verlor, ihr ein Arm amputiert werden musste und sie seit ihrer Evakuierung aus der belagerten Stadt in Paris im Filmbusiness arbeitet.
Žbanić verfolgt zahlreiche Assoziationsstränge und Erzähllinien, die ebenso um Fragen der Visualisierbarkeit von Traumata und Leiden, eines ethischen Umgangs mit gewaltvollen Bildern wie um die Schwierigkeiten des individuellen und gesellschaftlichen Weiterlebens angesichts der einschneidenden Erfahrungen von Krieg und Belagerung kreisen. Es geht ihr dabei nicht um eine Einschätzung der Kriegsereignisse oder einer ethnischen und religiösen Differenzierung von Tätern und Opfern, weshalb sie sich von den dominanten Diskursen der Zuordnung und Wertung bewusst abgrenzt und vielmehr an die Reflexionskraft der Zuschauer_innen appelliert, sich der eigenen Haltung zu stellen.
Als weiteres vielschichtiges Beispiel soll abschliessend Goran Devićs Dokumentarfilm Three (Tri, HR 2008) dienen. Er erforscht, was die in die Kämpfe involvierten Soldaten aller Kriegsparteien über zehn Jahre nach Kriegsende umtreibt, übertritt damit ein gesellschaftliches Tabu und öffnet den Blick für den Prozess der Versöhnung. Ursprünglich wollte Dević in seinem Filmprojekt die Geschichte des kroatischen Kriegsveteranen Ivica Petrić dokumentieren. Der Regisseur war auf ihn aufmerksam geworden, weil sich dieser in einem Zeitungsinterview darüber beklagt hatte, dass er während des Kriegs als Held gefeiert worden war und nun als Kriegsverbrecher geächtet werde. Die Einzigen, die ihn verstünden, so Petrić, seien andere ehemalige Krieger, egal ob aus den eigenen oder aus gegnerischen Reihen, mit denen er im Rahmen eines international organisierten Dialogs in Kontakt stand.
Devićs anfänglicher Plan, ein Porträt über den ehemaligen Kriegsteilnehmer in der Absicht zu realisieren, dessen Erfahrungen mit der kroatischen Erinnerungskultur in Zusammenhang zu bringen, änderte sich nach der zufällig während einer Autofahrt mitgefilmten Suada Petrićs. Denn sie stach aufgrund ihrer Vehemenz und der reflektierten Auseinandersetzung aus dem bereits reichlich vorhandenen Material heraus und gab den Ausschlag für das Konzept von Three: Drei Bekenntnisse über das Kriegs- und Nachkriegserleben von Veteranen der drei Kriegsparteien sollten miteinander verwoben werden, um daraus ein komplexes Bild des aktuellen Zustands der postjugoslawischen Gesellschaft zu zeichnen. Auf Basis der neuen Konzeptidee inszenierte Dević Gespräche mit dem für ihn eindrücklichen Serben Novica Kostić und dem Bosnier Narcis Mišanović im gleichen Setting wie mit Petrić: während einer Autofahrt vom Beifahrersitz aus gedreht. So entstand die Grundlage für Three, der seine Wirkkraft in der Gegenüberstellung der drei Stimmen mit unterschiedlichen ethnischen und damit verbunden national-ideologischen Perspektiven entfaltet.
Alle drei Protagonisten sprechen als selbstbestimmte, gleichwertige politische Subjekte über ihre Erlebnisse und ihr Handeln während des Kriegs und ordnen sie selbstkritisch ein. Sie hinterfragen den Krieg als Mittel zur Durchsetzung nationalistischer Ziele und zum Machterhalt und machen sich Gedanken über die Beweggründe und Rechtfertigungsmechanismen der Politik ihres jeweiligen Landes, ohne dass ihre Aussagen durch die filmische Struktur in ein kausales oder wertendes Verhältnis zueinander gestellt würden. Indem sie nicht nur Kritik an den gesellschaftlichen und politischen Praktiken üben, sondern auch die gesellschaftlichen Grundwerte und Normen rekapitulieren und reflektieren, wird in ihren Äusserungen ihr in die Zukunft gerichteter Blick auf das Entwicklungspotenzial der gesellschaftlichen Wirklichkeit erkennbar. Denn alle drei appellieren indirekt an eine gesellschaftliche Verpflichtung zur Anerkennung der eigenen Schuld und der eigenen Verantwortung und damit an einen gesellschaftlichen Wandlungsprozess. Durch das Konzept der dialogischen Kontrastierung bringt Dević – ohne eine ideologische Position zu beziehen – eine ethische Zugangsweise bezüglich der Reflexion von Krieg, Erinnerung und Verantwortung ins Spiel, indem er mittels Parallelisierung der drei Perspektiven Fragen des universell Menschlichen höher als jene der nationalen Eigenheiten gewichtet und so die Überwindung von Feindschaft zur Diskussion stellt.
Die wenigsten der hier aufgeführten Dokumentarfilme vermochten in der konkreten historischen Situation ins Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit vorzudringen. Ihre Bekanntheit in den Ländern des ehemaligen Jugoslawiens blieb meist auf Filmfestivals und private oder halböffentliche Vorführungen beschränkt. Diese Problematik ist ein grundlegendes Phänomen von kritischen Diskursen in schwierigen Zeiten, dennoch schmälert es nicht die Tragweite solcher Gegendiskurse. Denn zumindest in den jeweiligen Aufführungszusammenhängen können kritische Perspektiven mit ihrer inhaltlichen Ausrichtung ein politisches Bewusstsein aktivieren oder verstärken und innerhalb von oppositionellen Bewegungen ihre Wirkung entfalten. Die damit verbundene Hoffnung ist es wohl, die dazu führte, dass die an der Produktion und der Verbreitung von kritischen Standpunkten Beteiligten – selbst wenn sie sich ihres begrenzten Einflusses bewusst waren – nicht davon abliessen, sich stets von Neuem zu engagieren und mit ihren Dokumentarfilmen gegen die Haltung des jeweiligen politischen Establishments, aber ebenso gegen die Fehleinschätzungen der internationalen Meinungs- und Verhandlungsführer_innen anzutreten. Solche politischen Dokumentarfilme, die mit ihren vielfältigen Strategien, Zeitkritik ausgehend von gesellschaftlichen Werten und Idealen mit Zukunftsorientierung zu verschränken, sind als Teil eines kulturellen Widerstands zu verstehen, der zu jeder oppositionellen Bewegung gehört und in jedem hegemonialen System anzutreffen ist.
Über die Autorin:
Andrea Reiter ist Filmwissenschaftlerin und Dokumentarfilmerin. Am Seminar für Filmwissenschaft der Universität Zürich entstand ihre Dissertation «Kritik, Aktivismus und Prospektivität. Politische Strategien im postjugoslawischen Dokumentarfilm», die im September 2019 im Schüren Verlag erschienen ist.
https://www.schueren-verlag.de/programm.html?task=openaccess.download&file=9783741003417.pdf


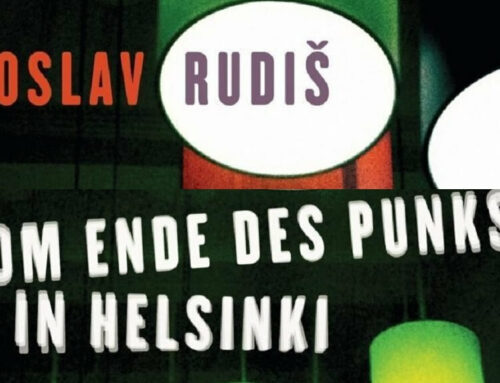
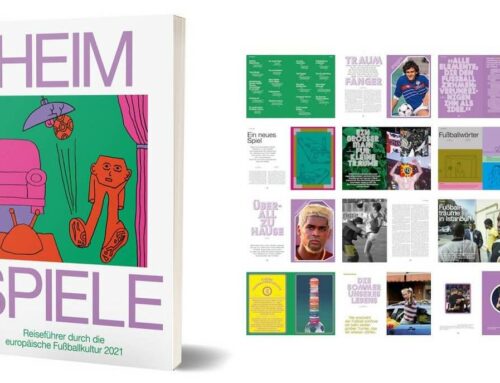

Hinterlasse einen Kommentar